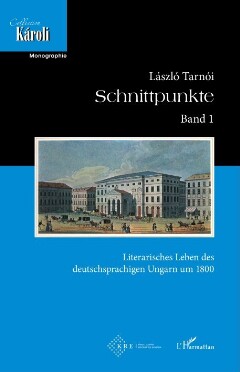Page 170 [170]
5. DAS DEUTSCHE SCHAUSPIELREPERTOIRE IM ALTEN PRESSBURG UND PEST-OFEN
wiederholten deutschen Aufführungen von Shakespeare, Goethe und vor
allem der Schillerdramen kamen diese Theater recht früh — im Falle von
Goethe und Schiller größtenteils noch zu Lebzeiten der beiden Dichter —
den breitesten einheimischen Zuschauerinteressen entgegen. Die meisten
Dramen von Schiller waren bereits wenige Jahre nach ihrer Entstehung
den Ungarn in Pest-Ofen gespielt. Die Räuber und Kabale und Liebe ab
1786, Fiesco schon um ein Jahr später, Don Carlos 1790, Die Jungfrau von
Orleans bereits im September 1803, nur 6 Monate nach der Erstaufführung
in Wien.” Das Jahr 1808 wurde in der Fachliteratur wegen der auffallend
vielen Schilleraufführungen wiederholt als „Pester Schillerjahr“ bezeichnet.”
Die frühen deutschen Schiller-Inszenierungen im alten Pest-Ofen trugen
auf eminente Weise dazu bei, dass dieser deutsche Klassiker im Königreich
besonders tiefe Wurzeln schlug und sein Werk innerhalb weniger Jahrzehnte
im Laufe höchst intensiver Rezeptionsvorgänge meist in vielen Varianten
auch ungarisch vorlag und wirkte. Tatsache ist, dass das Schiller-Oeuvre in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stets zunehmend sogar als organischer
Teil der ungarischen Literatur und Theaterkultur erlebt wurde.**
Pest-Ofen wurde außerdem im Königreich — ähnlich wie Wien in
Österreich — bereits zwei Jahrzehnte vor der Eröffnung des großen Theaters
zum Zentrum anspruchsvoller Operninszenierungen. Nach Recherchen von
Jolan Kädär wurde hier von 1793 bis 1811 allein die Zauberflöte 139-mal
gespielt.”
b) Schauspielkunst zur Unterhaltung und/oder Bildung
Freilich spielte man im alten Pest-Ofen nicht nur Klassiker. Das Repertoire
wurde im Grunde genommen von den gleichen Titeln beherrscht, denen man
damals in den TIheaterprogrammen des ganzen deutschen Sprachraumes
begegnete, so an erster Stelle von August Kotzebue, von dem man zwischen
1800 und 1811 in der Hauptstadt Ungarns 48 Stücke aufführte.“* Ihm
folgten August Wilhelm Iffland, Friedrich Julius Wilhelm Ziegler, Johanna
von Weißenthurn, Friedrich Ludwig Schröder, Franz Kratter und — um auch
ein allgemein beliebtes Stiick der Zeit zu nennen — Das Donauweibchen, ein
® Siehe in Schiller Magyarorszägon [Schiller in Ungarn]. Bibliographie. Zusammengestellt
v. Albert, Gábor, D. Szemző, Piroska u. Vizkelety, András. Budapest: Országos Széchényi
Könyvtár, 1959, S. 277. Siehe auch Kádár: A budai és pesti német színészet.
133 Kertbeny: Zur Theatergeschichte von Budapest. S. 849; Kadar, A budai és pesti német
szinészet, S. 82.
44 Vgl. Tarnói, Laszlo: ,,... er war [auch] unser“. Ungarns Friedrich Schiller. In: Balogh, F.
Andras. / Kurdi, Imre / Orosz, Magdolna / Varga, Péter (Hgg.): Im Schatten eines anderen.
Schiller heute. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, S. 203-218.
45 Kádár, A budai és pesti német színészet, S. 56; 131.
16 Ebd., S. 80 f.
«169 +