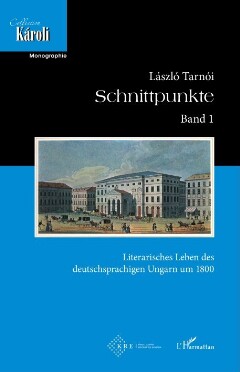Page 91 [91]
III. DIE DICHTUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN UNGARN UM 1800
ebenfalls den aufgeklärten Gedanken gemäß im scharfen Gegensatz zur
„leeren Pracht“ und zum „Modewind“ der westlichen Zivilisation. Die Natur
des Landes und die der Menschen seien nämlich nach Rösler — wie dies im
folgenden dritten Teil behauptet wurde — die Garantien für den wirksamen
Fortschritt „zur Höhe reifer Bildung“, denn - so heißt es später — „die Mensch¬
heit taugt für Treibhäuser nicht“. Nur diejenigen Menschen, welche die
Natürlichkeit dem Luxus nicht preisgeben, seien zur Entwicklung tauglich.
Der scharfe Gegensatz zu den gekünstelten „Nachbarn unsrer Abendgrenzen“
ließ ebenda durch einen angedeuteten antiösterreichischen Hinweis die
ungarische Identität noch stärker hervortreten. Im vierten Teil wurden
schließlich die Zukunftsvisionen vom „Völkerwohl“ und ihre Realisierung im
ungarischen Vaterland gepriesen. Ähnliche utopische Hoffnungen scheinen
auch in manchen zeitgenössischen Csokonai-Gedichten auf:
Ha! leuchte mir erhabner Genius
Des Völkerwohls mit deiner Fackel vor!
Und lasse mich im Geiste, jene Zeiten
Anbetend sehn, wo das Volk empor
Zum Ruhme deine Führungen einst leiten.
Dann preißt man nicht den Boden mehr allein,
Den deine Huld uns gab; dann nehmen
Für Thaten wir den Platz auf Klio’s Tafel ein,
Die jetz’gen Spötter zu beschämen.
Die anschließenden Schlussworte mit dem überschwänglichen Bekenntnis
des Dichters zu Ungarn enthielten wiederholt das Adjektiv „süß“, das in
ungarischen Gedichten und Texten schon immer als ein gängiges Epitheton
ornans des Substantivs Vaterland — möglicherweise auch über das Latein
vermittelt — verwendet wurde:
Dann fühlen doppelt wir den süßen Namen,
Den jeder Patriot noch süß empfand,
Und süß empfinden wird, den Namen —
Mein Vaterland!
In diesem patriotischen Kontext dürfte das Adjektiv „süß“ — sogar dreimal
wiederholt — deutschsprachig (besonders heutzutage) eher befremdend als
begeisternd nachempfunden werden. Im ungarndeutschen Gedicht wirkte
es seinerzeit gewiss auch wegen direkter sprachlicher Beziehungen zur
ungarischen Poesie mit natürlicher Selbstverständlichkeit.
Von einer noch größeren Bedeutung war jedoch seinerzeit, dass der auf das
ungarische Volk bezogene aufgeklärte und uneingeschränkte Zukunftsglaube im
+ 90 +