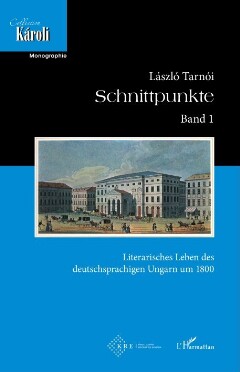Page 182 [182]
7. DAS DEUTSCHSPRACHIGE PEST-OFEN IM DIENSTE...
interessen der deutschen und ungarischen Theaterintendanten von Ofen und
Pest — geschweige denn an irgendeiner Art Diskriminierung der ungarischen
Kultur.
Man besuchte deutschsprachige Theatervorstellungen, weil das Publikum
in den Städten des Königreichs bis aufganz wenige Ausnahmen aus deutschen
Bürgern bestand, weil alle dort lebenden übrigen Einwohner — im Pest/Ofner
Durchschnitt um 1800 insgesamt etwa 20 Prozent — damals ausgezeichnet
auch deutsch verstanden,”® und außerdem, weil unter den ganz wenigen
ungarischsprachigen Städten die größte, das kalvinistische Debrecen, damals
an Theatervorstellungen genau so wenig interessiert war wie Zürich in Johann
Jakob Bodmers Zeiten. Über das ungarische Theater und im Zusammenhang
damit über Debrecen teilte der ungarndeutsche Berichterstatter des Neuen
Teutschen Merkurs (vermutlich Karl Georg Rumy) seinen Lesern im April
1802 folgende wichtige Informationen mit:
Das ungarische Theater hat sich, seitdem es aus Pest (wo es sich die schönsten
Früchte für die Zukunft zu versprechen schien) durch das dasige teutsche Theater
durch Chikanen des Direktors verdrängt wurde, nicht erholt, sondern ist seinem
Untergang nahe. Zwar existiert es jetzt noch in Debrezin, der volkreichsten Stadt
in Ungarn (sie hat 29.000 Einwohner), in der bloße Ungarn oder Magyaren wohnen,
aber es fehlt an Unterstützung und Aufmunterung. Es wird wenig besucht (am
meisten noch von wenigen daselbst ansäßigen Teutschen und den Studenten), weil
die meisten dasigen Einwohner - eifrige Anhänger des schwermüthigen Kalvins,
der Tanz und Musik verdammte — das Schauspiel zu besuchen für Sünde halten.
Das Personal der dasigen ungrischen Schauspieler ist größtentheils schlecht und
sie haben nicht einmal ein eigentliches Theater.’*
Das kulturelle Leben war in den Städten des Königreichs vom ausgehenden
18. Jahrhundert bis um die Zeit zwischen 1817 und 1822 auf allen Gebieten
überwiegend deutschsprachig.’® Diese deutschsprachigen Traditionen der
73 Siehe dazu Kap. II/5.
74 Der Neue Teutsche Merkur, 1802, H. 4, S. 271 f. Verfasser nach Starnes [siehe Kap. XI], S.
213, Nr. 1029: „[vermutlich Rumi, anhand von Mitteilungen anderer, teilweise aus einem
Brief vom 29. Nov. 1801 aus Jena von Joh. Sam. Dianovsky]“.
> Ab 1817 erschien in der Hauptstadt des Königreichs die ungarische Zeitschrift
„Tudomänyos Gyüjtemeny“ [Wissenschaftliche Sammlung] und im Jahre 1822 wurde
der erste Band des ungarischen Almanachs „Aurora“ veröffentlicht. Beide gelten in der
Literaturgeschichtsschreibung Ungarns als Meilensteine in der Entwicklung der ungarischen
Kultur. Ihre Bedeutung (sowie freilich auch die der davor ebenda ein Viertel Jahrhundert
lang veröffentlichten deutschsprachigen Zeitschriften) unterstreicht die Tatsache, dass vor
diesen beiden ungarischen periodischen Schriften 22 Jahre lang überhaupt keine ungarischen
Periodika in Pest-Ofen erschienen sind! Vgl. dazu Kökay, György (Hg.): A magyar sajtö
története [Die Geschichte der ungarischen Presse]. Bd. I, 1705-1848. Budapest: Akademiai
Kiadö, 1979, S. 831.
+ 181 +