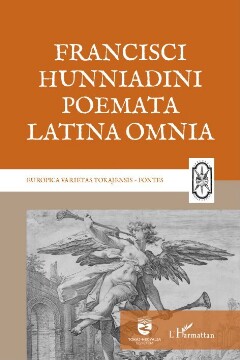Page 309 [309]
namens Emericus (er könnte vielleicht Imre Szikszai sein) geschrieben (inc. Hic iacet
Emericus gui nulli vixit amicus).
Trotz des Umstandes, dass ein Großteil der Quellen sich als Arzt auf Ferenc Hu¬
nyadi bezieht, ist hierzu die einstweilen einzige bekannte Spur, die vorhin schon
erwähnte Oxforder Handschrift: Brevis et compendiosa curatio febris putridae atque hec¬
ficae |Heilung des fauligen und starken Fiebers kurz und in Auszügen]. Es handelt
sich dabei eher um eine Rezeptsammlung, die er aus verschiedenen Quellen zusam¬
mentragen durfte. Er bietet detaillierte Rezepte aus Rosenwasser, Liliensaft, Essig,
Wein, Harzöl, Asche und diversen Pflanzen oder deren Säften: aus Endivie, Weizen,
Gerste, Spinat, Petersilie, Kamille, Aloe Vera usw. zur Behandlung von Fiebererk¬
rankungen. Für den Umschlag empfiehlt er den Patienten ebenfalls verschiedene Sal¬
ben, Tinkturen, schließlich schlägt er zur Linderung der Nebenwirkungen nach ei¬
ner langdauernden Fiebererkrankung (z.B. Austrocknung) an die zehn Rezepte. Das
Interessante dabei ist, dass nach Zeugnis des dichtbeschriebenen Seitenrands Hunya¬
dis Büchlein tatsächlich benutzt wurde, es verschwand also nicht in der Schublade
für lange Jahrhunderte.
Aus seiner Korrespondenz kennen wir nur fünf Posten. Den einen ofliziellen Bri¬
ef ohne Datierung adressierte er an Cinzio Passeri Aldobrandini. Den Brief dürfte
er im Sommer 1592, oder spätestens im Herbst geschrieben haben. Den anderen
undatierten Brief schrieb er an Papst Clemens VIII., wahrscheinlich im Jahr 1594.
Außerdem kennen wir von ihm zwei an Jänos Baranyai Decsi adressierten Briefe:
den einen schrieb er in der ersten Hälfte 1596, den anderen wahrscheinlich nach
1596. Die erste Antwort von Baranyai Decsi auf den ersten Brief vom August 1596
blieb ebenfalls erhalten. Seinen letzten bekannten Brief kennen wir aus dem bereits
früher erwähnten Niederschrift von Szamosközy über die Belagerung von Temesvar.
Der Brief berichtet Imre Szikszai über die Ereignisse des Tages 14. Juni 1596 und
der darauffolgenden paar Tage. Wir kennen noch zwei an Hunyadi adressierte Briefe
ohne Datierung: den einen schrieb ein gewisser P. Schlick, der sein Kind an Hunyadi
schickte, damit dieser den seit vier Jahren kranken Arm des Kindes untersuche, und
wenn möglich, möge er irgendein Rezept dafür verschreiben. Den anderen schrieb
Mátyás Aszalai, der zwei seiner Epigrammchen Hunyadi zukommen ließ.
Zusammenfassend: derzeit wissen wir soviel über das Leben und über die Werke
Ferenc Hunyadis. Unser vages Wissen über sein Leben ist eher ein auf Annahmen ru¬
hendes Herumtasten, als ein profundes Wissen. Aufgrund seiner erhalten gebliebe¬
nen Werke zeichnet sich das Bild eines über eine tiefe humanistische Bildung verfü¬
genden gelehrten Hofdichters vor uns ab, der sich vor allem im Hofmilieu entlang der
Achse Krakau-Karlsburg (Gyulafehervär/Alba Julia) am heimischsten fühlte. Sein
Schaffen ist aus mehrerer Hinsicht beachtenswert. Die eine ist, dass er mit seinen
manieristischen poetischen Bildern und Sätzen laufend hinter der schablonhaften
Rolle des Hofdichters der Außenwelt zublinzelt, die andere wiederum ist, dass die
ungarische Literaturgeschichte einen Korpus aus dem 16. Jahrhundert von diesem
307