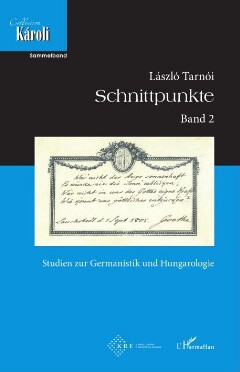Page 306 [306]
WEGE
Sonne schon droht unterzugehen und bei aufsteigendem Nebel und zuneh¬
mender Dámmerung die Konturen der Naturbilder allmáhlich verschwimmen.
Kurz vor dem Ziel hört man schließlich lautstark das Posthorn des Kutschers
ertönen, um Ankunft und Empfang am Reiseziel zu verkünden.
Ohne Zweifel sind wir, Leser des 21. Jahrhunderts, dank dieser Verse bzw.
ihrer authentisch vermittelten Bilder in all die momentanen Erlebnisse dieses
Weges vom 10. 10. 1774 versetzt. Doch wird uns dabei merkwürdiger Weise
wesentlich mehr als die heute bereits nahezu exotisch anmutende Kutschen¬
fahrt zuteil, indem wir gleichzeitig den 25-jährigen Goethe, die Persönlichkeit
des jungen Mannes zu jener Zeit aus allernächster Nähe vielseitig miterleben,
dabei sogar das, was er an dem entsprechenden Herbstnachmittag von sich
und von der Welt hielt.
Diese Art unteilbare Zweiheit der lyrischen Attitüden lässt schon der ener¬
gische Aufforderungssatz, mit dem das Gedicht von der Heimfahrt anhebt,
nachempfinden. „Spude dich, Kronos!“ — lautet es hier. Das heifst einerseits
ohne jeden Zweifel: Die Zeit ist dran, man beeile sich, der Weg nach Hause
muss schnellstens geschafft werden. Da geht es aber gleichzeitig doch noch
auch um viel mehr, nicht bloß um den etwa zweistündigen Weg nach Frankfurt,
sondern auch um Goethe selbst, um sein Leben, seinen augenblicklich erlebten
Lebensweg.
In einem rührenden Briefan die Mutter bekannte er, dass damals das „Un¬
verhältnis des engen und langsam bewegten bürgerlichen Kreyses zu der
Weite und [bitte beachten Sie das folgende Wort] Geschwindigkeit“ seines
„Wesens“ ihn beinahe „rasend“ gemacht habe.?
Von den Leiden dieser Art zeugt eine ganze Reihe von poetischen Bekennt¬
nissen des Dichters bereits vor der Entstehung des Gedichts An Schwager
Kronos. Dann soll aber der schrille Aufruf am Gedichtanfang nicht nur Pfer¬
de und Kutscher angetrieben haben. Dann ging es dabei auch, ja vor allem
darum, die Beseitigung der riesigen Spannungen zwischen individuellen Ver¬
anlagungen und objektiven Welterlebnissen endlich hinter sich haben zu
wollen.
Das gleichzeitige Erlebnis der beiden Wege erstreckt sich auf alle Details
der kurzen Fahrt nach Frankfurt. Die Lebensfahrt-Empfindung schwingt
bereits in der ganzen „bergab“-Strophe mit, wo uns bis vor deren letztem Vers
eigentlich nur lauter Konkreta des bergab rasenden Wagens vor Augen geführt
werden:
* Goethe an seine Mutter, den 11. 8. 1881. In: Goethe [Johann Wolfgang von]: Briefe und Tage¬
bücher. Bd. 1. Hg. v. Hans Gerhard Gräf. Leipzig: Insel-Verlag, o. J., Nr. 256, S. 339.
+ 305 +