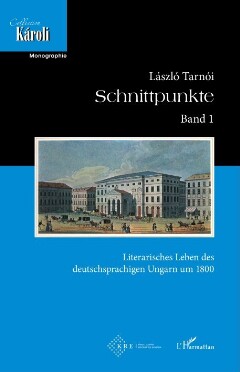Oldal 271 [271]
XI. DER NEVE TEUTSCHE MERKUR ALS QUELLE...
Solche nationalen Kontroversen waren in Ungarn am Anfang des 19. Jahr¬
hunderts tiberhaupt noch nicht typisch. Raum und Bedeutung gewannen
sie im kulturellen Leben Ungarns erst, nachdem von den 1820er Jahren
an in der Entwicklung der Kunst und Literatur die Romantik maßgebend
geworden war und sich der Gedanke des nationalen Aufstiegs immer
deutlicher zum tagespolitischen Programm gefestigt hatte. Eigentlich
passten solche Auseinandersetzungen 1802 und 1803 nicht einmal in die
Presselandschaft Deutschlands und am wenigsten in die Zeitung für die
elegante Welt und den Neuen Teutschen Merkur. Wahrscheinlich folgte aus
diesem Grunde in der Leipziger Zeitung trotz der Vorankündigung keine
Fortsetzung aus der Feder des Preßburger Deutschen. Die weit verbreitete
„elegante Zeitung“ war ein ausgesprochen unterhaltendes Organ gebildeter
Bürger. Der Herausgeber wusste genau, womit er den zeitgenössischen
Leserinteressen entgegenkommen konnte. In seiner programmatischen
Schrift ein Jahr zuvor setzte er sich vor allem für „heiter-witzige Schriften“
ein, wobei zu seinen wichtigsten Grundsätzen gehörte: „Dass man [...]
gar nichts, was auf Politik, Staatsverfassung zunächst Bezug hat, zusende,
weil solche unbenutzt liegen bleiben wird.“ So „heiter“ und „witzig“ das
Ungarnbild des Preßburger Einsenders auch skizziert war, so waren seine
Beziehungen zur „Politik“ und „Staatsverfassung“ letzten Endes gewiss
unverkennbar. Noch hervorstechender ist die Veröffentlichung der Ungarn¬
Studie im Neuen Teutschen Merkur. Für die zweifelsohne reichhaltigen
Informationen über Sprache und Kultur der Magyaren hatte Böttiger, der
ja die vielen Ungarn-Berichte veröffentlichen ließ, gewiss Interesse. Doch
hoben sich diesmal auch die wertvollsten Ungarninformationen vom dunklen
Hintergrund der diskriminierten übrigen Nationalitäten des Königreichs, vor
allem der Deutschen und Slowaken, ab. Dass dies den spätaufklärerischen
Prinzipien Böttigers in keiner Weise hat entsprechen können, beweist seine
Stellungnahme zur Ankündigung des „Musenalmanachs von und für Ungarn
auf das Jahr 1807 (von Professor Karl Georg Rumi zu Teschen), welcher
teutsche, ungarische, slavische und lateinische Gedichte enthalten soll“, in
der er Folgendes behauptete:
Der Redacteur des Neuen Teutschen Merkurs würde sich freuen, wenn dieser zur
Bestimmung der Stufe der Cultur, welche die in Ungarn freundlich zusammen
wohnenden romanischen, teutschen, slavischen und magyarischen Völkerstämme
erstiegen haben, sehr wohlberechnete Almanach erscheinen könnte [...] Er soll
Gedichte und Aufsätze in teutscher, ungarischer, slavischer und lateinischer
Sprache enthalten.’
50 ZEW, Intelligenzblatt, 1801, Nr. 5, S. 1.
51 NTM, 1807, H. 3, S. 222. (Hervorhebungen L. T.) Verfasser nach Starnes, Prosa-Artikel, S.
206, Nr. 953: „Rumi“.
s 270 +