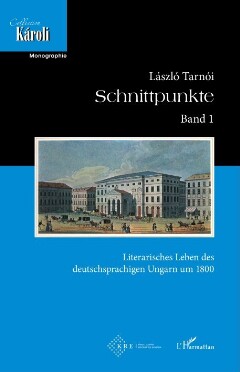Page 222 [222]

OCR
4. LUSTIGE BERICHTE EINES TÖLPELS AUS DEM ALTEN PEST-OFEN IN BRIEFEN Drucke bedurfte bereits eines unvergleichbar breiteren Konsumentenkreises als des unbeträchtlichen „Ischepeleter Publikums“. Noch wichtiger ist aber in diesem Zusammenhang, dass ein bäuerliches Publikum von Tschepel weder dem eigentlichen Inhalt noch der sonderbaren Art dieser merkwürdig grotesken Erzählweise jenes Verständnis und Interesse hätte entgegenbringen können wie der Pest-Ofener Großstadtbewohner, der mit den thematischen Details der Brieferzählung von vornherein auf das engste vertraut sein musste. Gewiss hätte aber in der Wirklichkeit auch kein ungebildeter Naturtalent seine eigene Unkultiviertheit mit so überzeugenden künstlichen Raffinessen nachempfinden lassen können, wie dies dem unbekannten Autor durch die unpolierte „Tschepeleter“ deutschen Regionalsprache (mit ausgewählten komischen Effekten des Dialektalen) sowie der verdrehten Fremdwörter eines halbgebildeten Lateiners und schließlich einer haarsträubend inkonsequenten Orthographie gelang. Dabei malte er gleichzeitig sonderbar großflächige Fresken von der Mode, der Mentalität, der Wohn- und Freizeitkultur, mit einem Wort des Alltags der mittleren und der niederen Schichten im alten Pest-Ofen - allerdings alles aus dem eigenartigen Blickwinkel seiner Tölpelfigur gesehen und jeweils mit recht grellen Farben und entstellter Durchzeichnung sämtlicher Einzelheiten. Das Dialektale veranschaulichte um 1800 bei dem damals bereits erreichten verhältnismäßig hohen deutschsprachigen Schreib- und Leseniveau der deutschen Belletristik in- und außerhalb des Königreichs recht oft Züge von Charakteren niederer sozialer Herkunft bzw. niedrigen Bildungsstandards. (Von manchen Autoren wurden zu diesem Zweck des Öfteren in den jeweiligen „schlechten“ deutschen Text bezeichnenderweise hin und wieder auch ungarische Wörter und Ausdrücke eingesetzt.*) Dies tat auch die freie, man könnte wohl behaupten regellose Handhabung der Orthographie der Rachschiml-Briefe. Wenn die Rechtschreibung auch in den übrigen deutschsprachigen Drucken um 1800 noch nicht als völlig einheitlich angesehen werden kann, erfolgte bereits seit den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts in zunehmendem Maße die Tendenz zur Vereinheitlichung, und wenigstens schuf man damals im Falle aller anspruchsvolleren Ausgaben größtenteils wenigstens die verhältnismäßige a Siehe z. B. im anonymen Heubauer-Lied „Gutya lantzos wollt mir sogen / Wann so ’s Weibsbild sich that trogen* [- —]: Heubauer-Lied. In: Lieder der Liebe, der Freude, und des Vergniigens. 4. Aufl. Pest: Joseph Leyrer, 1817, S. 30 f. In: Deutschsprachige Texte aus Ungarn, Bd. 1, S. 316 f. Siehe auch Duett des Pipi und Krambamboli. In: Hensler, Karl Friedrich: Der Teufelstein in Mödlingen. Darin heißt es u. a.: „Ick Magyarember bin erlicke Mann |[...] Ihr seyd bizony ördeg adta“. In: Theatralisches Liederbuch oder Sammlung der beliebtesten Arien, Duetten, Terzetten, Quartetten etc. aus Deutschlands vorzüglichsten Opern. Allen Theaterfreunden gewidmet. Pesth: Joseph Leyrer, 1810, S. 286. In: Deutschsprachige Texte aus Ungarn, Bd. 1, S. 152 £. e 221"
structurelles
Custom
Image Metadata
- Largeur de l'image
- 1831 px
- Hauteur de l'image
- 2835 px
- Résolution de l'image
- 300 px/inch
- Taille du fichier d'origine
- 1.3 MB
- Lien permanent vers jpg
- 022_000038/0221.jpg
- Lien permanent vers OCR
- 022_000038/0221.ocr