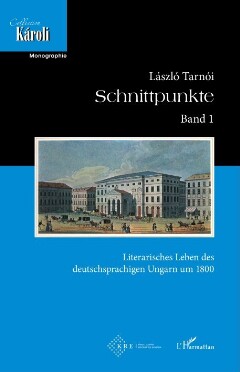Page 189 [189]
VIII. EINE GATTUNG OHNE GRENZEN...
Wesenserkenntnis und Klassifikation kann nur durch „den Einbruch der Zeit
[...] wiederhergestellt werden‘, falls „die Geschichte [...] zum Entstehungsort
des Empirischen“ wird.°
In diesem Sinne versuche ich im Weiteren das Allgemeine über den
Brief in der geistesgeschichtlichen Epoche der Aufklärung anzusiedeln
und das Besondere mit Brieftexten des deutschsprachigen Ungarn zu
veranschaulichen. Die Briefe drohen allerdings selbst bei ihrer historischen
und regionalen Konkretisierung im aufgeklärten Ungarn, mit ihren
vielfachen Erscheinungsformen, Funktionen und gattungstypologischen
Querverbindungen sämtliche Genres zu überschwemmen.
Es ist bekannt, in welchem Tempo im 18. Jahrhundert die Zahl der
lesekundigen bzw. lesebedürftigen Menschen in Mitteleuropa zunahm.
Nach statistischen Erwägungen von Rudolf Schenda sowie Helmuth Kiesel
und Paul Münch betrugen die Kennziffern dieser Entwicklung‘ in den
hundert Jahren mehr als tausend Prozent, in urbanen Bereichen etwa sogar
anderthalbmal so viel.” In Ungarn konzentrierte sich dieser enorme Zuwachs
des Lesekonsums zeitlich eigentlich auf etwa drei bis vier Jahrzehnte, auf das
letzte Jahrhundertquartal sowie auf die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts,
und regional auf die Städte, in erster Linie auf die nicht nur zur Hauptstadt,
sondern (unter den damaligen Verhältnissen) zu einer mitteleuropäischen
Metropole zusammengewachsenen Pest und Ofen.
Die Schleusen einer breit aufgefächerten aufgeklärten Lesekultur
hierzulande wurden 1784, im Josephinischen Jahrzehnt geöffnet, und sie
konnten 1794 mit den Anordnungen der strengsten Zensurmaßnahmen im
deutschsprachigen Mitteleuropa nicht wieder dicht gemacht werden. Dank der
gewonnenen Freude amLesen und am Schreiben entstanden vor und nach 1800
kontinuierlich weiter zunehmend handgeschriebene und gedruckte Texte.
Die „Lesebegierde“, wie die sich unaufhaltsam verbreitenden Leserinteressen
von Martin Kovachich bereits 1786 als eine symptomatische Tendenz in der
Geschichte der Kultur des Königreichs kritisch beurteilt wurde? seinach einem
ungarndeutschen Merkur-Korrespondenten anderthalb Jahrzehnte später
sogar zu einer unter dem deutschen Publikum „grassirenden“ „Lesesucht“
5 Schnur-Wellpott, Aporien, S. 5.
° Außer der Zunahme der Zahl der Leser auch die der Autoren und Drucke miteinbegriffen.
Siehe dazu Kap. II.
” Schenda, Rudolf: Volk ohne Buch. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1977, S. 444,
447. Vgl. dazu auch Kiesel, Helmuth / Münch, Paul: Gesellschaft und Literatur im 18.
Jahrhundert. Voraussetzungen und Entstehung des literarischen Markts in Deutschland.
München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1977, S. 15 f., 43, 161, 196 f. Vgl. dazu Kap.
11/5.
® Kovachich, Martin Georg: Ernstliche, aber wohlgemeinte Warnung an die begierigen Leser
der Modeschriften. In: Merkurvon Ungarn, oderLitteraturzeitungfür das Königreich Ungarn
und dessen Kronländer. Ofen: 1786, Jahrgang 1, Heft 11, S. 1088. In: Deutschsprachige Texte
aus Ungarn, Bd. 3, S. 17. Mehr darüber siehe in Kap. 11/3.
«188 +