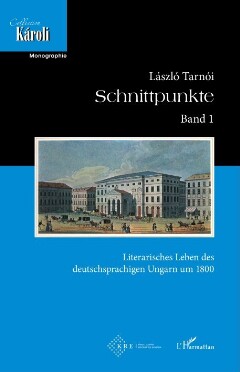Page 121 [121]
V. UNGARNDEUTSCHE HEIMAT- UND VATERLANDBILDER UM 1800
der Csanáder Pusztalandschaft, bei Bredetzky in den Bergen der Karpaten)
erhielt in ihnen einen höchst expressiven poetischen bzw. metaphorischen
Stellenwert,!! jeweils die Grenzen zwischen Heimat- und Vaterlanderlebnis
überschreitend. (Schedius hat in seiner Gruberkritik die Szeged-Darstellung
des Dichters mit jedem Recht als den poetisch wirksamsten Höhepunkt des
umfangreichen Gedichts gewürdigt.'?)
Andererseits wurde jene aufgeklärt kosmopolitische und christlich brüder¬
liche Weltsicht, an der katholische und protestantische ungarndeutsche
Intellektuelle im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in ihren Heimatstädten
(in Pest, Preßburg, Ödenburg oder in den Zipser Städten) und/oder im Ausland
(in Wien, Jena, Göttingen usw.) erzogen wurden, von den ausgehenden
neunziger Jahren immer stärker vor allem auf jene Volksgruppe konzentriert,
der man sich zugehörig fühlte. So waren Heimat, Volk, Nation im Begriff, in
einem einzigen Brennpunkt aufzugehen.
Ungarndeutsche Städter, deren Väter, vor diesen Entwicklungen nach
Ungarn kamen, erweiterten um die Wende zum neunzehnten Jahrhundert die
ursprünglich jeweils nur landesteilbezogenen Heimatempfindungen mit einer
Selbstverständlichkeit zu Identitätsbekenntnissen zum ganzen Lande. Dies
fiel ihnen umso leichter, da u. a. eine überaus bedrückende wirtschaftliche
Diskriminierung durch Zollbestimmungen des österreichischen Kaisertums
die Interessen der in den verschiedensten Teilen des Königreichs
beheimateten deutschen Stadtbürger viel mehr miteinander und dem
ungarischen Adel verband als etwa mit ihren Standesgenossen in Wien. Man
braucht dabei nur an die beiden gleichzeitig, jedoch unabhängig voneinander
entstandenen deutschsprachigen Schriften des Adligen Gregor Berzeviczy
und seines zipserdeutschen Landsmanns, des Theologen Jacob Glatz, über
die brutale Kolonialisierung des ungarischen Vaterlandes durch Österreich
zu denken’?.
Zur Ausdehnung der Landesteil-Grenzen der jeweiligen Heimat trug
freilich auch die um 1800 äußerst schnell vollzogene Zentralisierung des
deutschsprachigen kulturellen Lebens in der Pest-Ofener urbanen Region bei
- miteiner rasch zunehmenden Zahl von deutschen Verlegern, Buchdruckern,
Buchhändlern, Zeitschriften-Redakteuren, außerdem von Schauspielern
1 Siehe darüber ausführlicher Kap. III/2 u. III/3.
Rezension über den „Hymnus an Pallas Athene“ und den „Hymnus an Pannoni“. In:
Zeitschrift von und für Ungern zur Beförderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde
und Literatur von Ludwig Schedius, 1804. Bd. 6, H. 4, S. 258. In: Deutschsprachige Texte aus
Ungarn, Bd. 1, S. 344.
Berzeviczy, Gregor: Ungarns Industrie und Commerz. In: Neue Zeitung fiir Kaufleute,
Fabrikanten und Manufakturisten. Hg. v. J. A. Hildt. Weimar: 1802, Nr. 19-29. [Glatz,
Jacob]: Freymiithige Bemerkungen eines Ungars iiber sein Vaterland. Teutschland: 1799, S.
348. Auszüge aus diesen Publikationen siehe in Deutschsprachige Texte aus Ungarn, Bd. 3,
S. 27-69. Weiteres hierzu siehe in Kap. X/7 und XI/3.
«120 +