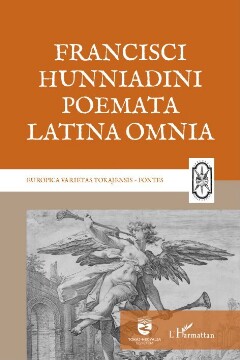Oldal 306 [306]
Schließlich kommen sie am 8. September in der Stadt des heiligen Markus an. Am
Ende der durch Österreich, Ungarn und Polen führenden Reise kommt Bäthory mit
seinem Gefolge in Krakau an. Der dritte Teil von Ephemeron fokussiert auf Andreas
Bäthory selbst und ist letztlich nichts anderes als ein Lobgedicht. Es knüpft an den
oben bereits erwähnten Stephan Bäthory-Panegyrikus enger an, als an das Epheme¬
ron selbst. Es lässt sich als eine Art Ergänzung der Familiengeschichte lesen, die die
Lobpreisung des polnischen Königs mit dem Lob des zukunftsvollen Neffen - mit der
Kindheit, den Jugendjahren und den Studien von Andreas - fortsetzt und abschließt.
Der Gedichtband O2 felicem Stephani ad oppidum Mechoviam adventum erschien
als Appendix des Ephemeron, gleichsam als dessen Fortsetzung oder eher als des¬
sen Epilog. Den Anhang selbst schrieb der Dichter aus dem freudigen Anlass, dass
Andreas Bäthory mehrere Monate nach seiner Rückkehr aus Rom Stephan Bäthory
endlich am 14. März 1585 in Miechöw traf. Dieser kleiner Band scheint im Verg¬
leich zu Ephemeron eher zusammengewürfelt. Er enthält elf Gedichte, von denen
allerdings die letzten drei nach Stephan Bäthorys Tod, also nach dem 12. Dezember
1586 an das von vornherein als Anhang bestimmte O2 felicem Büchlein angeheftet
wurden. Die mangelnde Integrität der Komposition verrät so etwas wie Hast oder
eine Art Überstürztheit. Hunyadi widmete das Büchlein Paul Gyulay, dem Sekretär
von Stephan Bäthory, obwohl das - laut den Quellen ausgesprochen herzliche und
intime — Treffen der beiden Bäthorys der eigentliche Anlass für die Gestaltung des
Bandes war. Die erste Komposition, ein Begrüßungs- und Lobgedicht in 223 Hexa¬
metern ist in neun Teile gegliedert. Nach einem 20 Hexameter langen Begrüßung¬
sprolog treten Bäthory lobpreisend der Reihe nach die unter seiner Herrschaft be¬
findlichen, beziehungsweise ihm untergebenen Provinzen, Länder: Polen, Litauen,
Russland, das Herzogtum Preußen, Livland, Podolien, Siebenbürgen vor sein An¬
gesicht. Das Gedicht selbst endet schließlich mit der Würdigung des Königshofes
selbst. Das andere größere Gedicht ist eine 28 Hexameter lange Oratio, die Stephan
seinem Neffen, Andreas, vorträgt. Vor den Trauergedichten finden sich noch weite¬
re drei kurze Epigrammen und Hymnen, die ebenfalls den König loben. Es ist die
Ironie des Schicksals, dass die vier Distichen lange, ursprünglich als abschließendes
Stück vorgesehene Hymne mit der Bitte an die Parzen endet, sie mögen gefälligst
einen langen Lebensfaden für Bäthory spinnen. Das taten sie nicht. Und so wird die
wegen des plötzlichen Todes des Königs einen Bruch erleidende - ursprünglich für
einen Jubelband bestimmte - Komposition mit drei aus 53 sapphischen Strophen
bestehenden hastig formulierten und in den Mund der Bäthory Brüder gelegten
Trauergesängen abgeschlossen.
Hunyadi ließ fast zwei Jahre nach dem Tod Stephan Bäthorys seine kurze An¬
thologie zum Tode des Königs herausgeben, die er in seinem Vorwort dem Fürsten
von Siebenbürgen, Sigismund Bäthory, widmete: Piis manibus D. Stephani Bathorei
quondam Poloniae regis inclytii. Von den zweiundzwanzig langeren-kiirzeren Gedicht¬
en betrauern einundzwanzig den Tod Bathorys, wobei das letzte Gedicht vielleicht
304