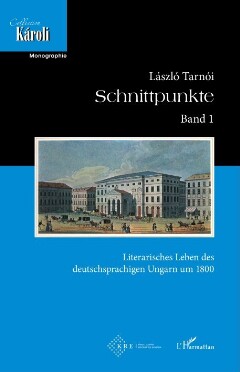Seite 261 [261]
XI. DER NEVE TEUTSCHE MERKUR ALS QUELLE...
der katholischen ungarischen Magnaten, der Grafen György Festetics und
Ferenc Széchényi, für den ökonomischen und kulturellen Fortschritt des
Landes, die bereits sehenswerten Resultate der Entwicklung der ungarischen
Sprache und Literatur, die Bildungsergebnisse in den protestantischen
Schulen (vor allem im ungarischen reformierten Kollegium in Debrecen und
in den deutschsprachigen Schulen in der Zips), die wissenschaftlichen und
belletristischen Publikationen der Ungarn und der Ungarndeutschen wie
auch erste Versuche der Slowaken und Rumänen.
Andererseits opponierte er als ein engagierter Bürger Ungarns gegen
die Kolonialisierung des Landes durch Österreich, gegen die bedrückenden
Zensurmaßnahmen sowie gegen jede religiöse und nationale Intoleranz. Es ist
daher kein Zufall, dass die Verbreitung mancher Merkurhefte in Österreich
und in Ungarn verboten wurde. Schon im dritten Heft von 1803 wurde dies
bestätigt: „Die ersten Stücke des Neuen Teutschen Merkurs von diesem
Jahrgange sind, so wie einige des vorhergehenden Jahrgangs, von der Wiener
Censur verboten [...] Die für Österreich anstößigen Artikel sind die Aufsätze
über Ungarn und Baiern.“”!
Der oppositionelle Charakter steigerte sich trotz aller Leidenschaft an
keiner Stelle bis zu irgendeinem revolutionären Standpunkt. Die erwünschten
Veränderungen wurden jeweils von oben bzw. von inneren Reformen
erwartet, so vor allem von den Landtagen und von den Einsichten des Königs.
Zu irgendeiner Art von Jakobinismus sind in diesen Aufsätzen keinerlei
Beziehungen nachzuweisen, nicht einmal in der recht begrenzten Form, wie
dies noch vor wenigen Jahren in den Freymüthigen Bemerkungen von 1799
leise anklang.? Kulturhistorisch ist die außerordentliche Bedeutung dieser
deutschsprachigen sozial- und kulturpolitischen Opposition sowie der damit
verbundenen Erwartungen von Reformmaßnahmen in den Ungarnbeiträgen
des Merkurs zwischen 1802 und 1805 vor allem darin zu sehen, dass sie in der
sozialhistorisch perspektivlosen Zeit zwischen der Französischen Revolution
und den Napoleonischen Kriegen, ein halbes Jahrzehnt nach dem Scheitern
der Verschwörung der ungarischen Jakobiner bereits frühe Tendenzen zu der
Vorgeschichte des so genannten „ungarischen Reformzeitalters“ zwischen
den zwanziger Jahren und 1848 verdeutlichen.
2 NTM, 1804, H. 3, 5.218 f. Verfasser nach Starnes, Prosa-Artikel, S. 178, Nr. 712: „vermutlich
Rumi“
Nicht einmal in diesem Werk wurden die Grenzen der reformistischen Verhaltensweise
überschritten, indem Jacob Glatz darin Folgendes schrieb: „Hier ist mein Bekenntniß: es ist
nicht erheuchelt. Wollt ihr mich nun einen Jakobiner schelten, so habe ich nichts dagegen.
Wenn derjenige Jakobiner heißen soll, der nur das für wahr erkennt, was ihm seine Vernunft
befiehlt, und der seine Ueberzeugung freymüthig an den Tag legt, so, ich gestehe es, verdiene
ich diesen Nahmen. Aber wer Verbesserung eines den Umsturz drohenden Gebäudes anräth,
der wünscht deßwegen nicht sogleich völliges Niederreissen desselben.“ In: Freymüthige
Bemerkungen, S. 42.
22
+ 260 +