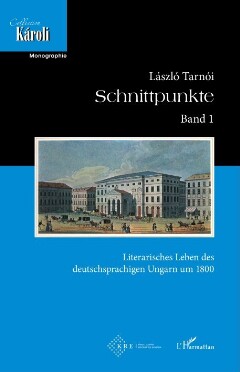Seite 213 [213]
IX. BELLETRISTISCHE PROSATEXTE DES DEUTSCHSPRACHIGEN UNGARN UM 1800
gleichzeitig dienenden und mehr oder weniger spannenden Geschichten
wetteifern. Solange die letzteren etwa dem Durchschnitt der deutschen
Trivialprosa entsprachen, blieben die Erzáhlungen von Gruber lediglich
epische Experimente mit dramatischen und lyrischen Texteinlagen und
nach deren Erzáhlweise dem urbanen Spátsentimentalismus verpflichtet.
Die unglaubwürdige Darstellung des Handlungsablaufs und der makellosen
„Tugend“ der Protagonist(inn)en konnte aber auch mit forciertem Einsatz
übertriebener sentimentaler Zeichensetzungen, für welche zwar die
zeitgenössischen Leser merkwürdiger Weise äußerst rezeptionsoffen waren,
kaum eliminiert werden.
Wenige Zeitgenossen kannten sich dabei in der Weltliteratur von dem
Altertum bis zur jüngsten Gegenwart so gut wie Carl Anton von Gruber
aus. Er las mit bewunderungswürdigem Fleiß und stets offenem Interesse
von den alten Griechen und Römern sowie von den Italienern, Franzosen
und Engländern und freilich von den neuesten deutschen und ungarischen
Autoren alles Mögliche?! in der jeweiligen originalen Sprache.” Trotz seiner
umfassenden Kenntnisse und seiner Anschließung an die neuesten geistig¬
kulturellen Tendenzen seines Landes und seiner Zeit, wie er das vor allem in
seinen beiden umfangreichen Hymnen (und auch in der höchstwahrscheinlich
von ihm verfassten Elegie™*) zum Ausdruck brachte, vertrat er bei der
theoretischen Auslegung seiner epischen Praxis längst überholte 'Ihesen
wie sie von Boileau bis etwa Thomasius, Wolff und Gottsched in Europa
kursierten. Danach habe es eine Art Hierarchie aller Werte gegeben, wobei
das „Schöne“ nur dem „Wahren“ und dem „Guten“ hätte dienen sollen. Von
der frühromantischen Widerlegung dieser Ihesen durch Friedrich Schlegel
und Schleiermacher, die Gruber, wie so vieles anderes genau kannte,?* fühlte
er sich höchst angewidert. Man lese dazu seine ausführlichen Argumente:
Ich habe bey der Bearbeitung des Ganzen mich immer an meinen Boileau erinnert,
der sagt:
Rien n’est beau, que le vrai. Le vrai seul est aimable.
Il doit régner par-tout, & même dans la Fable.
Man lese dazu z. B. Grubers Hymnus an Pallas-Athene. Presburg: Bey Georg Aloys Belnay,
1802, S. 55 u. dessen Anmerkungen.
Schon die vielen fremdsprachigen Zitate und deren Ubersetzungen in den beiden oben
besprochenen Erzahlungen belegen die besonderen Sprachkenntnisse des Dichters.
Weiteres dazu siehe im Kap. IV.
Friedrich Schlegels „Lucinde“ erschien 1799, „Die vertrauten Briefe über Friedrich Schlegels
Lucinde“ von Friedrich Schleiermacher ein Jahr später. Überraschend ist es dabei, dass
Gruber bereits im April 1802 dazu Stellung nehmen konnte! (Man bedenke, dass die
deutsch-ungarischen literarischen Rezeptionsvorgänge nicht lange davor im Durchschnitt
noch mehrere Jahrzehnte dauerten.)
+212 +