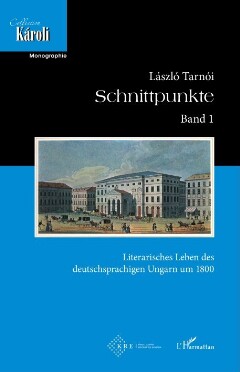Oldal 212 [212]
3. MODETRENDS IN DER BELLETRISTISCHEN PROSALITERATUR DER UNGARNDEUTSCHEN
Zweitens erfahrt man aber aus Grubers Worten, dass die Deutsch¬
sprachigkeit (die der Kultur und deren Rezeption) nicht nur in den Städten,
sondern auch in den kultivierten (Leser)kreisen des ungarischen Adels nach
1830 im ganzen Land noch immer äußerst stark vertreten war. Zeitlich und
thematisch stimmt die Grubersche Erklärung diesbezüglich vollkommen
mit den leidenschaftlichen Stellungnahmen überein, mit denen eine ganze
Reihe von Ungarn (wie z. B. István Széchenyi, Miklós Wesselényi, János
Hetényi, Mihály Vörösmarty und Sándor Vachott) in den dreißiger Jahren
die Deutschsprachigkeit bzw. die deutschsprachigen Leseinteressen des
weiblichen Adels kritisierte.?°
Die Handlung hat Gruber in ungarische Umgebung gesetzt und ließ darin
auch ungarische Gestalten unterschiedlichster Stände agieren. Trotzdem ist
in dem Erzähltext das vom Dichter beabsichtigte Ungarische recht spärlich
vorhanden. Alle ungarischen Beziehungen bestehen nämlich aus dem
Untertitel, dem Vorwort, den Eigennamen, manchen ungarischen Worten,
einer von Gruber verfassten ungarischen „Paramythie“ unter dem Titel
Lontz Es rösa (freilich auch deutsch: Das Wintergrün und die Rose) sowie aus
ungarischen Gedichten (von Verseghy, Revai etc.), wobei die letzteren schon
aus dem Grunde nicht besonders auffallen, denn in dieser Erzählung, wie
bereits in der Försterfamilie, der Erzähltext dauernd mit Zitaten aus Gedichten
der deutschen und der Weltliteratur unterbrochen wird, möglicher Weise um
wenigstensin dieser Beziehung den zeitgenössischen deutschen romantischen
Erzählungen von Tieck über Brentano bis Eichendorff einigermaßen folgen
zu können. Damit bzw. auch mit hin und wieder dramatisierten Textpartien
vermochte der Dichter während des Erzählens tatsächlich seine beiden
stärkeren Seiten (d.h. sein lyrisches und dramatisches Talent) nachempfinden
zu lassen.
Der Tenor dieser Geschichte ist aber erneut das Problem der Mesalliance
bzw. dass die biirgerliche weibliche Hauptgestalt, an eine Ehe mit dem
Angebeteten aus dem höheren Adel trotz gegenseitiger Liebe nicht einmal
denken dürfe. Sittliche Haltung heißt in diesem Falle, die Liebesleiden der
Hoffnungslosigkeit zu akzeptieren. Da gibt es freilich wieder schlaflose
Nächte, Seufzen, Schluchzen und Zähren, bis der epische „Salto mortale“
erneut alles zum Besten wendet: Es stellt sich dieses Mal heraus, dass die
Hauptgestalt Margit die Tochter eines Barons ist, so werden Margit und Lajos
bei vielen Eljen-Rufen ein glückliches ungarisches Brautpaar.
Die Epik von Gruber hat weder das Niveau seiner Prosaidyllen, (freilich
noch weniger das seiner lyrischen und dramatischen Werke) erreicht, noch
konnten sie mit Herdts interessanten, der Unterhaltung und der Erziehung
2 Vgl. dazu die kritischen Anmerkungen in: Vörösmarty Mihäly: Összes müvei [Sämtliche
Werke], Bd. 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960, S. 669-675.
e 211 e