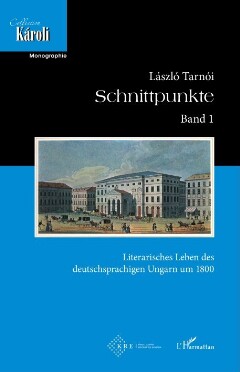OCR
3. DIE VERUNSICHERTE IDENTITAT — POESIE ENTTAUSCHTER DEUTSCHUNGARN Ihren Intentionen nach wirken diese vier Verse dem Genre entsprechend recht keck respektlos und intolerant.“ Andererseits wird aber diese poetische Attitüde in den Details leider mit lauter Irrtümern untermauert,** und ob der Tenor der eigentlichen Aussage ganz und gar seine Richtigkeit habe, dürfte auch zumindest für fragwürdig gehalten werden.“ Das Erscheinen dieses Vörösmarty-Epigramms markiert eine Phasengrenze in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur im Königreich. Die meisten deutschsprachigen Ungarn (unter ihnen vor allem diejenigen, die sich mit der ungarischen Nation bedingungslos identifizierten) fühlten sich etwa von dieser Zeit an, falls sie vor die Öffentlichkeit traten, von den ungarischen Schriftstellern immer wieder bedrängt und zur Verteidigung ihrer Nationalität und ihrer deutschen Muttersprache gezwungen. Das Erlebnis, unter Umständen aus der Nation, der man sich schon immer verpflichtet fühlte, ausgegrenzt zu sein, rief jene gemischten Empfindungen und Spannungen in vielen deutschen Dichtern des Königreichs hervor, die rund anderthalb Jahrzehnte lang in einer ganzen Reihe ihrer Werke poetisch reflektiert wurden, und die im Weiteren gehaltstypologisch dem Typ III zugeordnet werden. Bezeichnend für ihre Autoren ist, dass sie dank ihrer gleichzeitig starken Verbundenheit mit Ungarn freilich auch Gedichte verfassten, die nach ihrer poetischen Attitüde in den Typ I gehören. Gewiss fiel es einem ungarndeutschen Bürger besonders schwer, wenn er empfinden musste, dass die intolerante magyarische Sprachkritik gleichzeitig auch seine ungarnverbundene Vaterlandsliebe fragwürdig machte. Der später für Kossuth begeisterte Gustav Steinacker, dessen Lyrik im ersten Kapitelteil wohlbegründet dem ungarndeutschen „Vormärztyp I“ zugeordnet wurde, der mit Adolf Dux, Karl Maria Kertbeny zu den bedeutendsten deutschsprachigen Vermittlern der ungarischen Lyrik gehörte,” veröffentlichte z. B. bereits 1835 3 Das Epigramm ist ein lyrisches Genre, mit dem der Dichter schon gattungsgemäß (also wesentlich mehr als mit allen anderen Arten der Poesie) die Grenzen jeden Respekts und (bei umsichtiger Erwägung von Ideen und Mittel) eigentlich auch jeder sonst notwendigen Toleranz zu überschreiten ermöglicht - dies freilich jeweils im Interesse der Vermittlung authentischer poetischer Attitüden. (Den Nachweis für diese Art „Macht der Poesie“ lieferte Petőfi für Vörösmarty am 27.8. 1848 mit dem Gedicht „Vörösmartyhoz“ [An V.] - allerdings nicht in einem Epigramm.) Rumys Muttersprache war nicht slowakisch, sondern deutsch, sein hervorragendes Deutsch belegen seine in Wien veröffentlichte deutsche Stilistik sowie seine deutsch verfassten Studien und Briefe, schließlich wurde er von Christian Gottlob Heyne, dem Göttinger Professoren für klassische Philologie u. a. wegen seines ausgezeichneten Lateins und von Ferenc Kazinczy wegen seiner sprach- und literaturwissenschaftlichen Bildung geachtet und anerkannt. Nach dem Epigramm sei Rumys deutschsprachiges Oeuvre für die nationalen Interessen höchst schädlich gewesen. Dagegen sei an dieser Stelle nur an seine sechsjährige Propaganda im Weimarer Neuen Teutschen Merkur (1802-1808) für die ungarische Sprache und die ungarische Nationalliteratur erinnert. Vgl. dazu Kap. XI. Steinacker war z. B. der erste Nachdichter des „Szözat“ [Zuruf], des gewiss bedeutendsten und bekanntesten Gedichts von Vörösmarty. In: Der Ungar. Pesth: 1842, Jg. 1, Nr. 82, S. 457. 44 45 46 + 149 +
Structural
Custom
Image Metadata
- Image width
- 1831 px
- Image height
- 2835 px
- Image resolution
- 300 px/inch
- Original File Size
- 1.36 MB
- Permalink to jpg
- 022_000038/0149.jpg
- Permalink to ocr
- 022_000038/0149.ocr