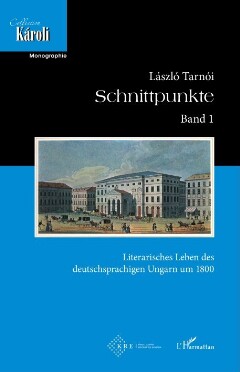OCR
4. MODIFIZIERTE UNGARNBILDER: INLANDISCHE SONDERFALLE Der Literaturwissenschaftler Ludwig Schedius und der Literaturorganisator Christoph Rösler versuchten Therese von Artner für ihre AlmanachProgramme zu gewinnen. Der Grund dafiir war ihr zweifellos ausdrucksvolles poetisches Talent. Gewiss konnte niemand im Königreich überzeugender als sie den in Deutschland gängigen Modetrends der städtischen Lesekultur” gerecht werden, wie diese um 1800 in der zeitgenössischen Almanach- und Journaldichtung gegenwärtig war. Beeindruckend waren auch die einmalige Formenvielfalt (von den klassizistischen Versen und Strophenformen bis zu den volkstümlich anmutenden poetischen Texten) sowie der Reichtum der Ihemen und Genres ihrer Gedichte (Lieder, Epigramme, Balladen, Oden, Fabeln). Was sie vor und nach 1800 mit den deutschsprachigen Intellektuellen des Königreichs verband war allerdings außer ihrem christlichen Glauben und ihrer Offenheit für die geistigen Werte der zeitgenössischen deutschen Kultur ihre entschiedene Ablehnung jeder Gewalt, wie sie dies in der Zeit der jakobinischen Diktatur in den lehrhaften Schlusszeilen einer ihrer Fabeln mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck brachte: Es giebt euch Sclaverey, wenn ihr nach Freyheit schmachtet, Es stürzt euch tief, wenn ihr nach Ruhm und Größe trachtet! Der Sultan und das Volk hegt gleichen Wankelsinn, Der lohnt euch durch den Strick, dies durch die Guillotinn’. °* Für Therese von Artner war aber Ungarn unter unserem Aspekt weder die Heimat noch die Fremde. Dass sie dort lebte, war für sie eine Art Selbstverständlichkeit — so auf diese Weise eigentlich nie fremd. Dass sie zu dieser Umwelt, zum jeweiligen Ort, zu den dort lebenden Menschen und ihrer Denkungsart kaum Beziehungen entwickelte, wenigstens solche in ihrer Dichtung nur ganz selten reflektierte,?® wurde diese ihre Umwelt für sie auch nie die eigentliche Heimat in engerem und breiterem Sinne des Wortes. ® Sie war damals zum Teil spätaufklärerischen Tendenzen und größtenteils dem Sentimentalismus verpflichtet. Vgl. dazu Tarn6i, Läszlö: „Unterhaltungslyrik der »eleganten Welt« in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts“. In: Impulse. Aufsätze, Quellen, Berichte zur deutschen Klassik und Romantik. Berlin / Weimar: Aufbau-Verlag, 1982, S. 222-252. (= Impulse Bd. 4.) 34 Artner, Therese von: Der Hengst. Eine Fabel, 1793. In: Feldblumen auf Ungarns Fluren gesammlet von Nina und Theone. Bd. 1. Jena: J. G. Voigt, 1800, S. 69-74. In: Deutschsprachige Texte aus Ungarn, Bd. 1, S. 16-18. 35 Eine beachtenswerte Ausnahme ist „Der Kirchtag“ v. Therese Artner mit der detaillierten Darstellung eines Volksfestes in Hexametern [angegebenes Entstehungsjahr: 1796] in der Art der etwa gleichzeitig entstandenen deutschen Idyllendichtung. In: Deutschsprachige Texte aus Ungarn, Bd. 1, S. 38 ff. «127 +
Szerkezeti
Custom
Image Metadata
- Kép szélessége
- 1831 px
- Kép magassága
- 2835 px
- Képfelbontás
- 300 px/inch
- Kép eredeti mérete
- 1.14 MB
- Permalinkből jpg
- 022_000038/0127.jpg
- Permalinkből OCR
- 022_000038/0127.ocr
Bejelentkezés
Magyarhu