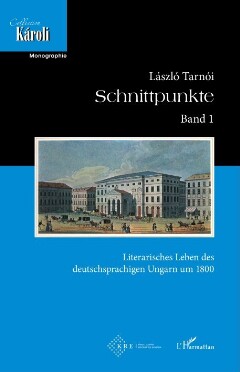Oldal 63 [63]
III. DIE DICHTUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN UNGARN UM 1800
Mit der Ihematisierung der ungarischen Geschichte, mit dem pathetischen
Ausdruck der Ungarnidentitát des deutschsprachigen Verfassers, mit der
Gegenüberstellung der heroischen Vergangenheit und der Gegenwart
bzw. der Zukunftserwartungen und schließlich mit der klassizistischen
Formensprache sind eigentlich sämtliche gehalts- und formtypologische
Beziehungen zwischen dem ungarndeutschen Gedicht und der ungarischen
Lyrik (von Berzsenyi über Kölcsey bis zum jungen Vörösmarty) deutlich
vorhanden.
Indem aber Bredetzky die Heldentaten der Ahnen (vor allem von dem
landnehmenden Fürsten Ärpäd in den Strophen 4 und 5) feiert, entsteht
allmählich ein Vokabular folgender, letzten Endes eher abstoßender als
anziehender Begriffe und Bilder:
2. Strophe: fürchterlich, schwarz wie grause Wolken
3. Strophe: Tod und schimpfliche Fesseln
4. Strophe: ungestüm [eine Modalbestimmung zur Handlungsweise von Ärpäd],
Tod und Schrecken
6. Strophe: Ströme von Blut, blasser [als sonst] strahlendes Antlitz des Phöbus,
Leich auf Leichen gethürmt
Demnach steigert sich in diesem historischen Mittelteil die eigenartige
Metaphorik bis zu den vollends befremdenden „Blutströmen“ und „aufge¬
türmten Leichen“ der Vergangenheit. Die inneren Spannungen zwischen
diesen befremdenden Empfindungen wegen der Kriegsfolgen und andererseits
der gleichzeitigen pathetischen Identifizierung mit Ungarns landnehmendem
Fürsten und seiner historischen Sendung geben der Bredetzky-Ode die
persönliche Note.” Erst beim Übergang zur Gegenwart (am Anfang der 7.
Strophe) beginnen sich diese merkwürdigen Spannungen allmählich zu
lösen: Die „Heldenthaten“ „schimmern“ nur noch, demzufolge verwandelt
sich der einstige Ruhm in kaum definierbare subjektive Erinnerungsbilder
des „Nachruhms“ im „Jetzt“. Der in der Mitte des zweiten Verses mit „Nun“
beginnende Aufforderungssatz mit seinem Enjambement schließt endgültig
alles Gewesene energisch aus und wendet den Blick in die „goldene“ Zukunft
des ewigen Friedens.
Samuel Bredetzky, hellhörig für die neuesten Ansprüche und Tendenzen
in der Dichtkunst, verwendete dabei die variierte sapphische Strophe, wie
man sie in einigen Oden von Klopstock vorfindet. Denn genauso wie in
diesen Gedichten des deutschen Vorbildes wurde auch in Bredetzkys Ode
der Daktylus in den ersten drei Versen der sapphischen Strophe nicht wie
” Nach meinen bisherigen Kenntnissen dienen die unzähligen Vergangenheitsbilder der
ungarischen Lyrik um den landnehmenden Fürsten Ärpäd jeweils der uneingeschränkten
Anerkennung seiner Heldentaten ohne jedes Wenn und Aber.
+ 62 +