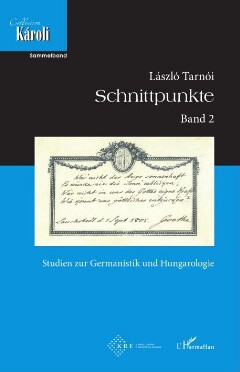OCR
LÁSZLÓ TARNÓI: SCHNITTPUNKTE. STUDIEN ZUR GERMANISTIK UND HUNGAROLOGIE summiert in ihrer ersten Hälfte schließlich die typische Ho(e)ck’sche These: Alles sei vergänglich, man sei aus dem Nichts gekommen, und genauso verschwinde man in dem Nichts: Nichts ist der Ruhm / nutz oder Gwin/ Auß nichts ist alls herkummen / Wies her geht / geht’s auch wider hin / Und wird zu nichts widerummen.” Man wird dabei an das Fleming-Sonett Bey einer Leichen erinnert, in dem am Ende einer langen Kette von Vergänglichkeitsmetaphern die Bilanz von der Nichtigkeit des Lebens mit den Worten „Nichts ist alles, du sein Schein“ gezogen wird. Aber Ho(e)cks Konsequenz führt hier noch weiter. Nach seinen Schlussworten wäre es dem Menschen besser gewesen, gar nicht geboren worden zu sein: Drumb wers schier je / so gut wen nie Der Mensch ein Mensch thet werden / Weil er doch auff der Erden / So kurtz hat zbleiben hie.** Dass dieser verzweifelte Gedanke in Ho(e)cks Dichtung kein Einzelfall war, ja sogar auch unmittelbar auf sich selbst bezogen wurde, dafür gibt es mehrere Beispiele: Der Author beweint das Leben,* so lautet die Überschrift eines Gedichtes, hiermit gleichzeitig die poetische Attitüde des Dichters und seines ganzen lyrischen Bandes charakterisierend. Da steigert sich der Verfasser aus persönlicher Enttäuschung, Kummer und Hoffnungslosigkeit bis zur Abscheu vor dem eigenen Leben, ja sogar bis an die Grenze der Todessehnsucht hinein, wenn er sich seiner Kindheit mit folgenden Versen erinnert: Ach wers nit Sünd so wünschet ich gar billich / Das mein liebe Mutter willig / Im ersten Bad ertrenckt het gleich oder Auff dWelt gebracht mich toder / Und das mein leben anfang und das ende / Nit lenger als die zende“. 4 Ebd., S.28 f. 44 Ebd., S. 29. 45 Ebd., S. 20—24. Zitat: 3. Strophe 46 Záhne « 20 «
Szerkezeti
Custom
Image Metadata
- Kép szélessége
- 1830 px
- Kép magassága
- 2834 px
- Képfelbontás
- 300 px/inch
- Kép eredeti mérete
- 817.64 KB
- Permalinkből jpg
- 022_000039/0020.jpg
- Permalinkből OCR
- 022_000039/0020.ocr
Bejelentkezés
Magyarhu